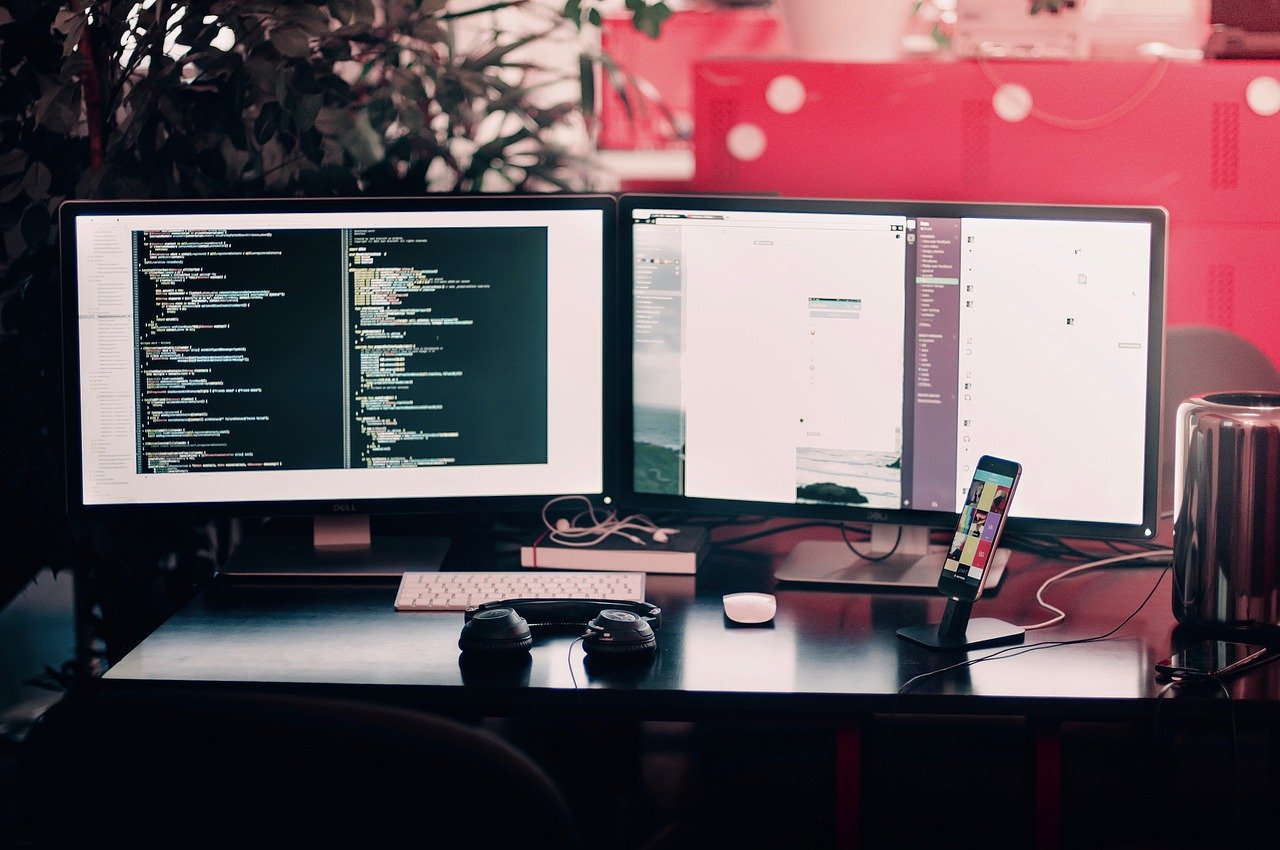Studie: Beinahe-Gewinne an Spielautomaten scheinen nicht zum Weiterspielen zu motivieren

Drei Forscher der Universität in Alberta, Kanada, Jeffrey M. Pisklak, J. H. Yong und Marcia L. Spetch, haben in diesem Monat im Journal of Gambling Studies eine ausführliche Studie über den sogenannten „Near-Miss-Effekt“ im Glücksspiel veröffentlicht.
Die Studie knüpft an die jahrzehntealte Theorie an, dass Spieler an Spielautomaten deutlich häufiger zum Weiterspielen verleitet werden, wenn Sie bei einem Spin fast gewinnen (bspw. die ersten beiden aus drei Gewinnsymbolen gleich sind), als wenn alle der angezeigten Gewinnsymbole unterschiedlich sind.
Die Forscher führten dazu verschiedene Experimente und Simulationen sowohl mit Menschen als auch mit Tauben durch und kamen zu dem Schluss, dass der Near-Miss-Effekt keine Auswirkungen auf das Spielverhalten habe.
Ein 66 jahrealter Mythos widerlegt?
Im Jahr 1953 präsentierte der weltberühmte Psychologe B. F Skinner († 1990) erstmals seine Theorie des „Near-Miss-Effektes“ aus der Verhaltensforschung. Seiner Ansicht nach motiviere ein vermeintlicher „Beinahe-Gewinn“ eine Person dazu, dieselbe Handlung erneut durchzuführen.
Bezogen auf das Glücksspiel, insbesondere auf Spielautomaten, griffen unzählige Forscher das Konzept in den vergangenen Jahrzehnten auf. Skinners Idee schien weitgehend als akzeptiert und Studien versuchten, diese eher zu bestätigen als zu widerlegen.
Selbst zu den Herstellern kommerzieller Spielautomaten war der Near-Miss-Effekt durchgedrungen. So setzten manche Betreiber von Slot-Machines in den 60er und 70er Jahren einen vermeintlichen Trick ein, der heute ohne Zweifel illegal wäre.
Die Geldspielgeräte enthielten neben den normalen Walzen mit Gewinnsymbolen sogenannte „Dummy Signals“. Diese sollten für den Spieler den Anschein erwecken, dass es sich um das direkt darüberliegende Gewinnsymbol handelte. Stoppten die Walzen zum Beispiel auf Kirsche, Kirsche, Zitrone, war über der Zitrone erneut eine Kirsche zu sehen.
Die Forscher der Universität Alberta studierten diesbezüglich sämtliche Studien, die zum Thema durchgeführt worden sind. Keine der Studien habe jedoch statistisch eindeutige Beweise für Skinners Theorie liefern können.
Während die Forscher den “Near-Miss-Effekt“ an sich nicht leugnen, zweifeln sie dennoch dessen Auswirkungen auf das Spielverhalten an. So räumen sie jedoch ein, dass die rein körperlichen Effekte eines „Beinahe-Gewinnens“ nicht zu leugnen seien.
Mehrere Studien hätten gezeigt, dass bei Probanden im Augenblick des fast Gewinnens der Herzschlag beschleunigt und die elektrische Leitfähigkeit der Haut sowie die Gehirnaktivitäten erhöht seien.
Von Tauben und Menschen
Auf der Suche nach eindeutigeren Ergebnissen planten die Forscher ausgiebige Tests an Menschen sowie Tauben. Beide „Probanden-Gruppen“ wurden dabei sehr ähnlichen Tests unterzogen.
In Experimenten aus der Verhaltensforschung kommen Tauben sehr häufig zum Einsatz. Diese gelten nämlich unter Forschern als intelligent und dennoch leicht durchschaubar. Sie verfügen über exzellente visuelle Genauigkeit, simple Motivationsmechanismen und schnell wechselnde Gehirnaktivitäten.
In den Experimenten von Pisklak, Yong und Spetch kamen acht Tauben zum Einsatz. Diese wurden in geräumige Käfige platziert, in welchen sich ein Touchscreen-Monitor befand, der lediglich auf das Picken mit dem Schnabel reagierte. Dort angezeigt wurde eine vereinfachte Simulation eines Slots. Gewinnsymbole waren rote Kreise, alle weiteren waren schwarz.

Tauben als perfekte Untersuchungsobjekte in der Verhaltungsforschung (Bild: Flickr/Christoph Rupprecht)
Um einen „Spin“ auszulösen, mussten die Tauben auf einen weißen Kreis picken. Bei einem Gewinn (drei rote Kreise) öffnete sich eine Tür mit einem „Belohnungs-Snack“.
Die Forscher wollten wissen, ob die Tauben häufiger erneut „pickten“, wenn zuvor die erste und zweite „Walze“ einen roten Kreis zeigten. Dies habe sich jedoch nicht bestätigt.
Dasselbe Experiment mit denselben simplen Gewinnsymbolen wurde dann mit 296 Menschen (192 Frauen, 104 Männern) durchgeführt. Zu gewinnen waren Geldbeträge und Spieler starteten mit 50 Cent Startguthaben.
Jeder Spin kostete 5 Cent, jeder Gewinn brachte 40 Cent ein. Die Spieler hatten die Möglichkeit, nach beliebiger Zeit aufzuhören und den bis dahin erspielten Geldbetrag mitzunehmen.
Zuvor waren die Spieler in zwei Gruppen aufgeteilt worden: eine Gruppe wurde nach 300 Spins mit deutlich mehr „Beinahe-Gewinnen“ konfrontiert als die andere. Nach Auswertung ihres Spielverhaltens habe sich kein statistisch bedeutsamer Unterschied zwischen beiden Gruppen gezeigt.
Übertragbarkeit auf die Realität fraglich
Während die Studienergebnisse durchaus interessante Einsichten geben, haben Pisklak und Co. eingeräumt, dass die Übertragung auf die Realität des Glücksspiels im Casino oder Internet nur begrenzt möglich sei.
Spieler hätten beispielsweise nicht ihr eigenes Geld setzen müssen und somit nichts zu verlieren gehabt. Des Weiteren verfügten tatsächliche Spielautomaten über zahlreiche weitere Stimuli, die Einfluss nehmen könnten. Auch sei während des Experimentes kein Zufallsgenerator angewandt worden, wie es bei echten Slots der Fall sei.
Nicht zuletzt seien die Teilnehmer keine regelmäßigen Glücksspieler oder gar Problemspieler gewesen. Bei diesen habe bspw. der Forscher Simon Dymond im Jahr 2014 nachgewiesen, neuro-biologisch deutlich stärker auf den Near-Miss-Effekt zu reagieren.
Um Skinners Theorie in Bezug auf das moderne Glücksspiel also endgültig zu bestätigen oder zu widerlegen, würde es weiterer und realitätsnäherer Studien bedürfen.