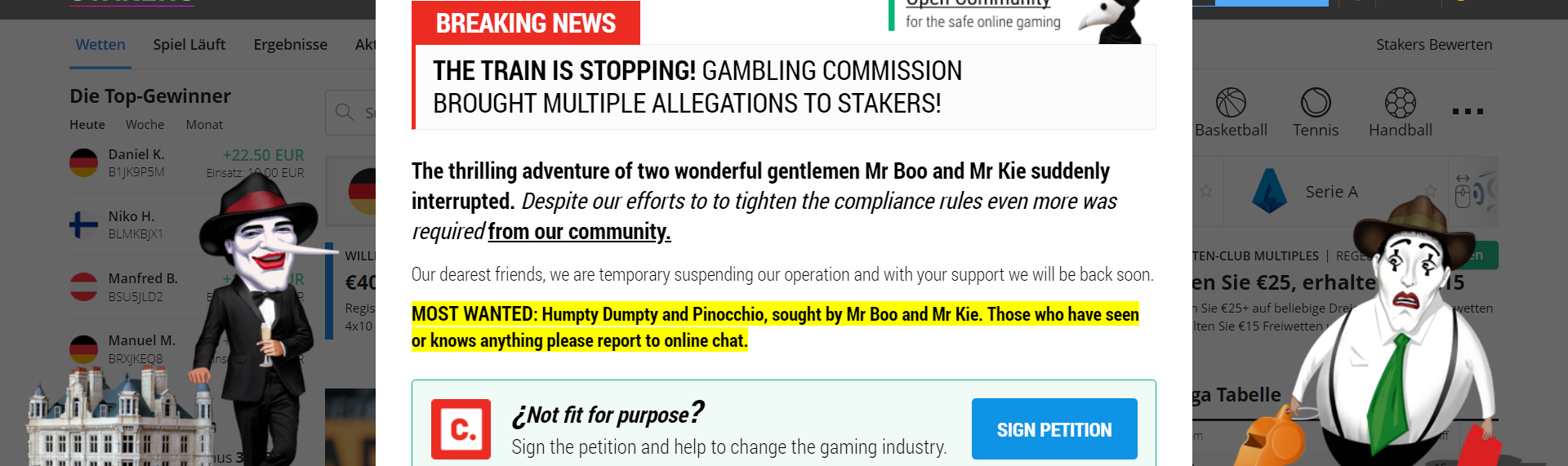Danke für die Blumen! Ein Wirecard Manager packt aus

Vom deutschen Vorzeige-Unternehmen zum Skandalkonzern: Seit der Insolvenzanmeldung von Wirecard fragen sich Marktbeobachter, wie es zum Absturz des Unternehmens kommen konnte. Jörn Leogrande, ehemaliger Executive Vice President von Wirecard, gewährt in seinem in dieser Woche erschienenen Buch „Bad Company“ nun Einblicke in das Innenleben des Unternehmens. Über die Geschäftspraktiken des unter anderem als Glücksspiel-Zahlungsdienstleister fungierenden Konzerns, aber auch die Zusammenarbeit mit den Managern Markus Braun und Jan Marsalek teilt er dabei seine bisweilen sehr bedenklichen Ansichten.
Zu den brennendsten Fragen rund um den Fall des Konzerns gehört, wie das Geschäftsmodell des Finanzdienstleisters, der auch von Glücksspiel-Anbietern genutzt wurde, wirklich aussah. Leogrande bekennt zwar gleich zu Anfang seines Buches, nicht zum „Kreis der Mitwisser“ gehört zu haben, beschreibt aber gleichwohl eingehend die zweifelhaften Geschäftspraktiken der Wirecard-Spitze.
High-Risk-Transaktionen und virtuelle Blumenläden als Geschäftsmodell
Am Anfang sei das Geschäftsmodell laut Leogrande die Abwicklung von Bezahltransaktionen in den Bereichen Porno und Glücksspiel gewesen. Dies sei zwar nicht illegal, jedoch zumeist anrüchig. Hinzu komme, dass es sich bei den Transaktionen, die Wirecards Zahlfunktion ermöglichte, um Hoch-Risiko-Geschäfte gehandelt habe. Der Grund dafür: Chargebacks, also die Rückabwicklung von Zahlungen. Leogrande schreibt:
Wirecard war eine auf High-Risk-Transaktionen spezialisierte Payment-Bude, Chargebacks waren folglich an der Tagesordnung. Warum ist das so? Nehmen wir einfach an, dass ein Kunde im Online-Poker eine empfindlich große Summe verloren hat. Er könnte in seiner Verzweiflung behaupten, dass er die initiale Kreditkartentransaktion gar nicht selbst getätigt hat und die Zahlung zurückziehen.
Werden die Chargebacks zu hoch, drohen dem Zahlungsabwickler vonseiten der Kreditkartenanbieter empfindliche Strafen. Wirecard, so Leogrande, sei führend gewesen, wenn es um Strafen in Millionenhöhe an Visa und Mastercard gegangen sei.
Doch nicht nur das hohe Risiko sei problematisch gewesen, sondern auch das illegale Glücksspiel. Da Online-Poker in den USA zum Teil illegal ist, hätten Zahlungsanbieter nach Lösungen für die unauffällige Zahlungsabwicklung gesucht.
Diese hätten kleine Online-Shops mit unverdächtigen Produkten geboten: Blumenläden, Shops mit Nahrungsergänzungsmitteln oder jeder anderen Art von verderblichen Waren, deren Existenz nach kurzer Zeit schon nicht mehr nachvollziehbar sei. Auf den Kreditkartenabrechnungen der Spieler sei damit lediglich ein unverdächtiger Shop zu sehen gewesen.
Ein Großteil der Einzahlungen von US-amerikanischen Pokerspielern in den Jahren 2003 bis 2006 lief über erfundene Blumenläden. Und weil natürlich nicht ein einziger Blumenladen die gesamten Zahlungsflüsse eines amerikanischen Online-Casinos darstellen konnte, mussten Hunderte von Flowershops gebaut werden.
Wirecard habe sich dabei lediglich als technischen Service-Dienstleister gesehen. Mit Risiko bewerteter Content sei schließlich nicht vom Unternehmen selbst geliefert worden. Es habe lediglich die Zahlungsabwicklung übernommen.
Dies sei im Fall vom US-Glücksspiel-Business bis zum Jahr 2006 möglich gewesen. Dann habe die politische Entwicklung den gesamten Markt verändert.
Im Jahr 2006 brachte die Regierung unter George W. Bush den Unlawful Internet Gambling Envorcement Act (UIGEA) auf den Weg – eine verschärfte Version der bisherigen Glücksspielgesetze. Fortan stellte der UIGEA die Akzeptanz von Zahlungen für das Online-Glücksspiel unter harte Strafen. Bis zu fünf Jahre Haft drohten jedem, der Zahlungen für illegale Online-Casinos anbiete.
Seit Inkrafttreten des Unlawful Internet Gambling Envorcement Acts hätten Reisen in die USA für die Wirecard-Geschäftsführung der Vergangenheit angehört.
Nach dem Black Friday: Die Geburt der Third-Party-Geschäfte
Da das Business mit Gambling (und Porno) auf die Dauer generell zu risikoreich geworden sei, hätten die Vorstände Jan Marsalek und Markus Braun dafür gesorgt, dass diese Geschäfte nicht mehr mit dem Wirecard-Modell in Verbindung gebracht worden seien. Im Jahr 2016 sei es komplett nach Dubai ausgelagert und dort von Oliver B. geleitet worden. So sei das Third-Party-Konzept entstanden.
Hierbei habe Wirecard als outgesourcter Zahlungsabwickler für ausländische Finanzdienstleister fungiert. Dieser Geschäftsbereich sei unabhängig von der Kernorganisation Wirecards abgewickelt worden:
Die meisten Wirecard-Manager gingen wie ich davon aus, dass Wirecard aus Reputationsgründen das hochprofitable Zahlungsgeschäft rund um Adult Entertainment und Online-Glücksspiel durch das Third-Party-Geschäft outsourcte. Für diese Logik gab es gute Gründe: Dem strahlenden DAX-Konzern hätte die Nähe zu zweifelhaften Transaktionen und zu Händlern, die in den Grauzonen des Internets agierten, in vielerlei Hinsicht geschadet.
Für Mitarbeiter, die wie der Autor nicht der Gruppe der Mitwisser angehört hätten, sei das Third-Party-Geschäft völlig in den Hintergrund gerückt. Nur selten habe sich jemand bemüht, Zweifeln und Vorbehalten auf den Grund zu gehen. Dies sei einer der Gründe, warum der groß angelegte Betrug bei Wirecard möglich gewesen sei.
Schwieriger CEO und Quereinsteiger im Vorstand
Auf die Drahtzieher Jan Marsalek und Markus Braun fällt im Buch jedoch auch hinsichtlich ihrer Persönlichkeit kein gutes Licht. So beschreibt Leogrande Braun als „Sith-Lords“ mit merkwürdigem Gebaren.
Jan Marsalek, der sich derzeit auf der Flucht befindet, beschreibt der Autor wie folgt:
Streichholzkurze Haare, besessen von militärischem Gehabe, für mich ein Zwangsneurotiker erster Güte, so etwa wenn es um die Anordnung der Stühle am Konferenztisch geht. Der Typ, der mir einmal sagte, dass er nie geheiratet hat, weil er zu konzentriert auf Perfektion und Symmetrie ist.
Marsalek sei für Leogrande ein Beispiel für das Einstellungskonzept bei Wirecard gewesen. Vorzugsweise seien Quereinsteiger eingestellt worden, die nach Worten des Autors viel zu sehr mit der Kompensation ihrer fehlenden Qualifikation beschäftigt gewesen seien als damit, nach „links und rechts“ zu schauen. Jan Marsalek habe weder Abitur noch eine abgeschlossenes Studium.

Jörn Leogrande beschreibt auch die Personalpolitik von Wirecard als zweifelhaft.
Auch Markus Braun sei alles andere als ein „Tech-Papst“ gewesen. Von Technologie habe der promovierte Wirtschaftsinformatiker erstaunlich wenig Ahnung gehabt. Ein entspanntes Verhältnis habe zu dem CEO niemand gehabt und der Autor selbst habe nie genau gewusst, nach wie viel „Autismus“ seinem Chef gerade „zumute“ sei.
Die größte „Freakshow“ jedoch habe Oliver B. geliefert, der später die Geschäfte in Dubai übernahm. Er habe auf den Autor gewirkt, wie ein „junger Mann aus bestem Haus“. Habe der ehemaliger Eliteschüler jedoch zu reden begonnen, sei das Bild völlig in sich zusammengebrochen.
Der Ghettoslang-Fan habe sich in sein Büro einen 24-Zoll-Monitor bringen lassen, auf dem er den Ego-Shooter „Call of Duty“ spielen konnte, begleitet von gut hörbaren „cheap kills“ und „bitches“. „Legendär und gefürchtet“ jedoch sei seine Ausländerfeindlichkeit gewesen. In einer Situation habe er sich beispielsweise beim Autor in Anwesenheit eines „farbigen Mitarbeiters“ entschuldigt, „dass er seinen Hund noch nicht richtig auf Schwarze abgerichtet“ habe.
Ein Hinweis auf den Verbleib der verschwundenen 1,9 Milliarden Euro, die Wirecard schließlich das Genick brachen, oder eine „investigative Geschichte über Geldflüsse“ liefert der Autor, wie er im Prolog erklärt, nicht. Dafür aber erhält der Leser zumindest einen Einblick in die Funktionsweise des ehemaligen deutschen Vorzeigekonzerns und kann erahnen, wie es dem Unternehmen jahrelang gelungen ist, seine Praktiken erfolgreich zu verschleiern.